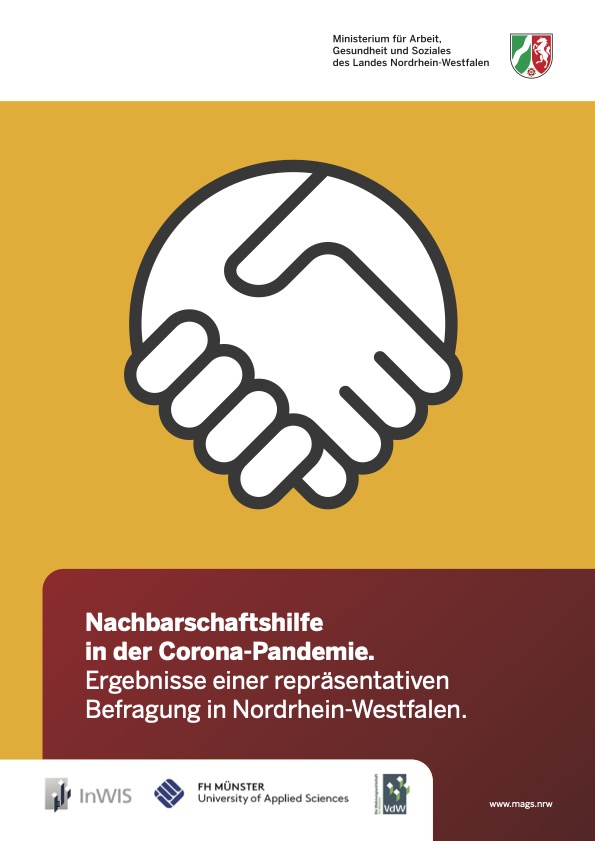
20 März Nachbarschaftshilfe in der Corona-Krise
Während die Fieberkurve der Zahlen der Infizierten mit dem Coronavirus täglich dramatisch steigt, die Märkte einbrechen und die politischen Verantwortungsträger im angespannten Krisenmodus arbeiten, scheint es so, als würden Menschen ihre Nachbarn wiederentdecken und solidarisch werden. Bilder von Aushängen für nachbarschaftliche Unterstützung im Quarantänefall machen die Runde, ebenso Medienberichte über Online-Foren zur nachbarschaftlichen Unterstützung im Krisenfall. In diesem Beitrag möchte ich anhand von vier Thesen diese Entwicklung diskutieren, geleitet von der Frage, ob die zu sehende nachbarschaftliche Unterstützung etwas Neues ist und wer von der Solidarität profitiert und wer nicht.
Wir erleben den Normalfall der Nachbarschaft
Es mag eigenartig klingen, doch nachbarschaftliche Solidarität tritt vor allem in Krisenfällen auf. Ein Beispiel sind Hochwasser oder Hausbrände, aber in der vorindustriellen Zeit auch die Notwendigkeit schnell die Ernte einzuholen, vor allem wenn Regen drohte. Die Nachbarn halfen und helfen. Es ist also eher der Normalfall den wir beobachten können: Es gibt eine krisenhafte Situation und nachbarschaftliche Solidarität tritt auf. Besonders ist eher, dass wir die Unterstützungskraft der Nachbarschaft in einer Gesellschaft der Risikominimierung und Krisenindividualisierung gerne vergessen (wollen). Das ist auch logisch, denn normalerweise brauchen nicht so viele Haushalte wie heute Hilfe von den Nachbarn, z.B. im Quarantänefall, oder wollen versichert sein, dass sie selbst Hilfe bekommen würden. Das Coronavirus bedroht uns aber alle potenziell, daher ist die Versicherung der nachbarschaftlichen Solidarität nun keine individuelle Sehnsucht mehr, sondern eine allseits gleichzeitig geteilte. Zugleich sind wir auch (theoretisch) alle in der Lage Solidarität zu leisten, den es geht um einen Austausch von unentgeltlichen Dienstleistungen und nicht von Waren. Dass Krisen der Normalfall der Nachbarschaftshilfe sind, soll diese nicht schmälern. Es erinnert uns aber daran, dass Nachbarschaft ein selbstverständlicher Teil der Krisenbewältigung ist, den jeder von uns hat. Wir müssen nur wieder lernen mit dieser Solidarität umzugehen.
Nicht alle werden in die Solidarität eingewoben
Listen für Erledigungen für Angehörige von Risikogruppen im Hausflur oder große Telegramm- oder Facebookgruppen sowie Hinweise auf lokale Nachbarschaftsplattformen vermitteln das Bild, dass alle die gleiche Chance auf nachbarschaftliche Solidarität hätten. Das stimmt so aber nicht. Es gibt mehrere Grenzlinien zwischen und auch innerhalb von Nachbarschaften, welche dazu führen, dass nicht alle von Solidarität profitieren. Auf drei Aspekte möchte ich näher eingehen. Auf der Hand liegt, dass in strukturschwachen und überalterten Landstrichen es kaum mehr genügend Menschen gibt, die im Zweifel mobil und leistungsfähig genug sind, um alle Angehörigen einer Risikogruppe im Ernstfall zu unterstützen und dabei weiterhin einer Arbeit nachzugehen. Die demografische Struktur einer Nachbarschaft bestimmt also das Ausmaß nachbarschaftlicher Solidarität im Krisenfall mit.
Aber auch andere Merkmale spielen eine Rolle und hier ist Rassismus klar zu benennen. Als das Coronavirus in Wuhan ausbrach und sich stetig verbreitete, mieden Menschen in Europa systematisch asiatische Restaurants und Geschäfte. Ähnlicher Marker zur Grenzziehung nachbarschaftlicher Solidarität sind auch in Bezug auf andere Gruppen zu erwarten. Die Geschichte lehrt uns, dass es bei Krisen stets die Suche nach Sündenböcken gab, es gibt keinen Grund zu glauben, dass das heute anders sein soll. Zumeist sind Opfer solcher Mythen dann als fremd markierte Gruppen, ob nun religiöse oder eine ethnische Minderheiten.
Der dritte Aspekt bezieht sich auf soziale Ungleichheit, oder genauer ihre Folgen. Unsere Städte werden intern immer ungleicher, arm und reich wohnen immer seltener in der gleichen Nachbarschaft. Das heißt aber auch, dass die Armutskonzentration in einigen Stadtteilen zunimmt. Das kreuzt sich mit dem Wissen aus zahlreichen Studien, dass arme Stadtteile einen zusätzlich benachteiligenden Effekt haben und zur Entsolidarisierung führen. Dort ist das Solidarpotenzial aufgrund von Enttäuschungen, Misstrauen und einer hohen Problemdichte geringer. Daher ist kaum zu erwarten, dass in den ärmsten Stadtteilen das gleiche Ausmaß der Nachbarschaftshilfe zu sehen sein wird, wie in mittel- und oberschichtsgeprägten Wohngebieten.
Digitale Medien machen Solidarität erfahrbar
Vor allem durch die digitalen Medien wurde die aktuelle Welle der nachbarschaftlichen Solidarität überhaupt erst sichtbar, seien es die schon angesprochenen Listen im Hausflur oder die Balkonkonzerte, die auf social media viel Aufmerksamkeit erfuhren. Das wird Nachahmer provoziert haben. Digitale Erfahrungen wurden dann also zu Impulsen für mikro-lokales handeln. Die Coronakrise zeigt, dass das Internet eine Erweiterung oder Ergänzung von Nachbarschaft ist, sie aber nicht ersetzt. Der vermeidliche Untergang der Nachbarschaft durch die digitale Kommunikation ist ausgeblieben. Eher tragen digitale Kommunikationswege dazu zur Modernisierung und Erzählbarkeit der Nachbarschaft bei. Für die Zeit nach der Coronakrise heißt es, dass das Verhältnis von digitaler und nachbarschaftlicher Praktiken genauer untersucht werden sollte.
Nachbarschaftliche Solidarität kann gesichert werden, wenn man sie fördert
Auch wenn die Krise vorbei geht, bleibt die Erfahrung der nachbarschaftlichen Unterstützung(sbereitschaft). Darauf kann aufgebaut werden, um den als bedroht angesehen gesellschaftlichen Zusammenhalt wieder deutlich und nachhaltig zu stärken. Dafür braucht es aber engagierte Nachbarschaftsprojekte, gestärkte digitale und lokal ausgerichtete Austauschforen und Gelegenheiten des alltäglichen Wiedersehen. Dabei können bewährte Ansätze der gemeinwesenorientierten Sozialen Arbeit helfen, aber auch freizügig geplante Plätze im öffentlichen Raum, lokale Versorgungsinfrastruktur und auch die Nummer vom Nachbarn im Smartphone, sollte mal wieder was sein.
Weiterführende Literatur

Sorry, the comment form is closed at this time.